Die Begriffe „marktbasierte“ und „standortbasierte Emissionen“ beziehen sich auf zwei verschiedene Methoden zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen des Geltungsbereichs 2, also der Emissionen im Zusammenhang mit dem von einem Unternehmen gekauften Strom, Wärme und Dampf. Die EU legt großen Wert auf Ziele für erneuerbare Energien, Energiemärkte und Emissionshandelsmechanismen, die Einfluss darauf haben, wie Organisationen ihre Emissionen bilanzieren. Diese Unterschiede werden im Folgenden erörtert.
1. Standortbezogene Emissionen
Diese Methode berechnet die Emissionen auf Grundlage der durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Netzes an dem Ort, an dem die Energie verbraucht wird. Dabei werden nicht die spezifischen Stromverträge eines Unternehmens berücksichtigt, sondern der breitere Mix aus Energiequellen (z. B. Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien), die im regionalen Netz verwendet werden. Nehmen wir beispielsweise an, dass ein in New York tätiges Unternehmen 1.000 MWh Strom verbraucht. Das regionale Netz in New York wird durch einen Mix aus fossilen Brennstoffen, Kernenergie und erneuerbarer Energie versorgt, was zu einem durchschnittlichen Emissionsfaktor von 500 kg CO₂ pro MWh führt. Nach dem standortbasierten Ansatz würden die Scope-2-Emissionen des Unternehmens wie folgt lauten:
1.000 MWh × 500 kg CO₂/MWh = 500.000 kg CO₂ (oder 500 Tonnen)
Diese Berechnung ist unkompliziert und basiert auf den durchschnittlichen Emissionen des regionalen Netzes, unabhängig davon, ob das Unternehmen grüne oder erneuerbare Energie gekauft hat.
2. Marktbasierte Emissionen
Der marktbasierte Ansatz berücksichtigt die tatsächlichen Emissionen, die mit den spezifischen Stromkäufen eines Unternehmens verbunden sind. Diese Methode berücksichtigt Verträge für erneuerbare Energien, Stromabnahmevereinbarungen (PPAs) oder Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs), die ein Unternehmen möglicherweise hat. Sie ermöglicht es Unternehmen, geringere Emissionen geltend zu machen, wenn sie Strom aus erneuerbaren Quellen kaufen. Beispielsweise verbraucht dasselbe Unternehmen in New York 1.000 MWh Strom, hat jedoch einen Vertrag zum Kauf von 100% seines Stroms von einem Solarpark unterzeichnet, der keine Kohlenstoffemissionen erzeugt. Nach dem marktbasierten Ansatz würden die Scope-2-Emissionen des Unternehmens wie folgt lauten:
1.000 MWh × 0 kg CO₂/MWh (da aus erneuerbarer Energie) = 0 kg CO₂
Hier werden die Emissionen des Unternehmens auf Null reduziert, weil es Strom aus einer CO2-freien Quelle kauft, auch wenn das weitere Netz weiterhin CO2 ausstößt.
Somit liefern die standortbasierten Emissionen einen Emissionsgrundwert auf Grundlage der allgemeinen Kohlenstoffintensität der örtlichen Stromversorgung, während die marktbasierten Emissionen die Emissionen aus der Energie widerspiegeln, die das Unternehmen unter Berücksichtigung von Investitionen in grüne Energie vertraglich zu kaufen verpflichtet ist.
Scope 2-Schätzung in der Europäischen Union
Beim Vergleich marktbasierter und standortbasierter Emissionen in der Europäischen Union (EU) ergeben sich aufgrund der Energiepolitik, der regulatorischen Rahmenbedingungen und der Netzdynamik der Region mehrere wesentliche Unterschiede. Die EU legt großen Wert auf Ziele für erneuerbare Energien, Energiemärkte und Emissionshandelsmechanismen, die Einfluss darauf haben, wie Organisationen ihre Emissionen erfassen.
In der EU spielen Herkunftsnachweise (GOs) eine entscheidende Rolle im marktbasierten Ansatz zur Emissionsbilanzierung. Im Rahmen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU werden für jede Megawattstunde (MWh) erzeugten erneuerbaren Stroms Herkunftsnachweise ausgestellt. Unternehmen, die erneuerbaren Strom kaufen, können mit Herkunftsnachweisen geringere marktbasierte Emissionen geltend machen. Herkunftsnachweise liefern den Nachweis, dass der Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne oder Wasser stammt, sodass Unternehmen in ihrer Kohlenstoffbilanz geringere Emissionen ausweisen können.
Die standortbasierte Methode in der EU basiert auf dem nationalen oder regionalen Netzmix. Obwohl die EU ihren Anteil an erneuerbarer Energie erhöht hat, verfügen viele Länder immer noch über Energiesysteme, die in unterschiedlichem Maße von fossilen Brennstoffen (z. B. Kohle, Erdgas) abhängig sind. In Regionen mit kohlenstoffintensiveren Energienetzen bleiben die standortbasierten Emissionen höher, selbst wenn die Organisation erneuerbare Energie über GOs kauft.
Wir bieten eine Vergleichstabelle der beiden Methoden in der EU angesichts ihrer strengeren Vorschriften
| Aspekt | Marktbasiert | Standortbasiert |
| Energiemix | Spiegelt vertragliche Käufe von erneuerbarer Energie über Herkunftsnachweise wider | Spiegelt die durchschnittliche Emissionsintensität des nationalen oder regionalen Netzes wider |
| Nutzung erneuerbarer Energien | Beinhaltet den Kauf erneuerbarer Energien, der durch GOs oder Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) abgesichert ist. | Spiegelt den tatsächlichen Anteil erneuerbarer Energien am Netzmix wider |
| Regulierungsmechanismen | Gebunden an die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien und GOs | Kein direkter Link zu Herkunftsnachweisen, basierend auf Rasterdaten |
| Variabilität nach Land | Geringe marktbasierte Emissionen in Ländern mit hohem Anteil erneuerbarer Energien (Deutschland, Dänemark) | Die standortbezogenen Emissionen variieren je nach Energiemix des Landes (z. B. niedriger in Schweden, höher in Polen). |
| Einfluss der CO2-Bepreisung | Indirekter Einfluss des EU-EHS auf Energiebeschaffungsentscheidungen | Indirekter Einfluss: Durch die CO2-Bepreisung werden die Energienetze in Richtung Dekarbonisierung verschoben |
| Bilanzierung von Emissionsgutschriften | Organisationen können Emissionen durch den Kauf von Instrumenten für erneuerbare Energien (GOs) reduzieren. | Keine Gutschriften oder Instrumente, spiegelt nur die Netzrealitäten wider |
Wir veranschaulichen die Funktionsweise anhand von Österreich, Schweden, Deutschland und Polen.
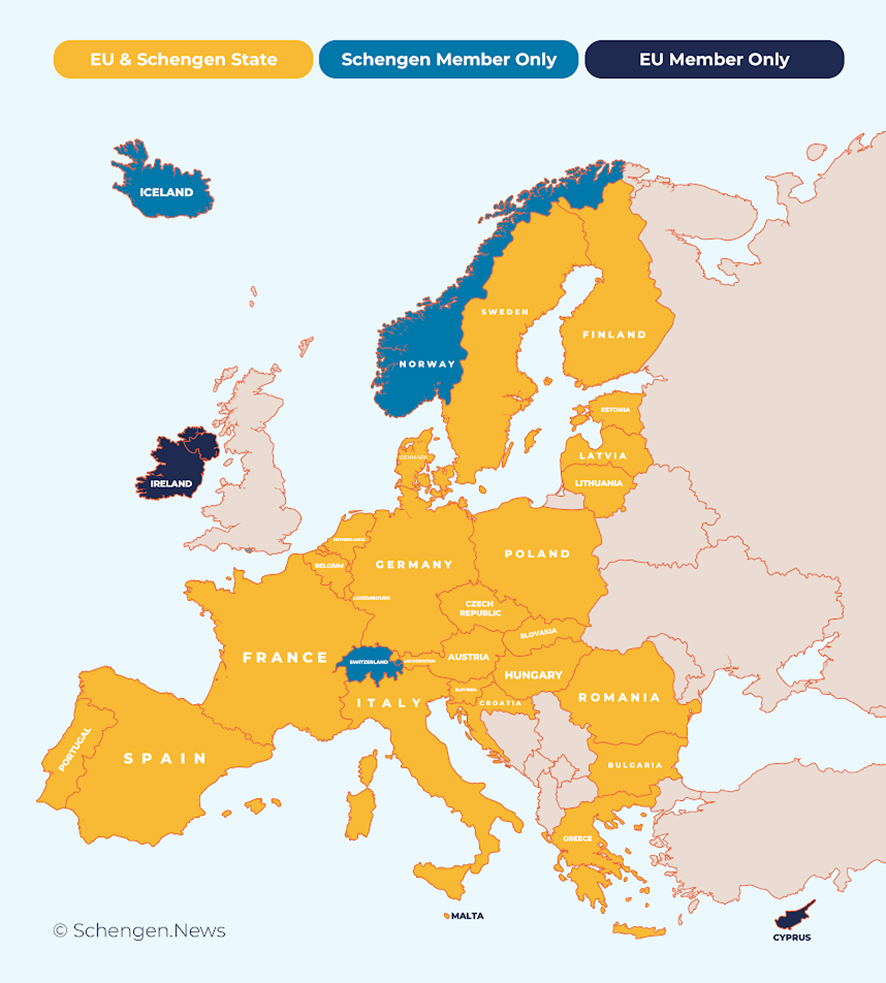
EU-Mitgliedsländer (Quelle: https://schengen.news/schengen-area-member-countries/)
Marktbasierte Emissionen: Ein in Wien ansässiges Unternehmen, das erneuerbare Energie von einem Wasserkraftproduzenten unter Verwendung von Herkunftsnachweisen kauft, wird sehr niedrige oder sogar keine marktbasierten Scope-2-Emissionen ausweisen.
Österreich:
Marktbasierte Emissionen: Sehr gering, wenn Unternehmen erneuerbare Energie mit Herkunftsnachweis kaufen, insbesondere aufgrund der großen Wasserkraftkapazität Österreichs und der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.
Standortbezogene Emissionen: Niedrig, da das österreichische Energienetz überwiegend aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Wind und Sonne gespeist wird und damit eines der saubereren Netze in Europa ist.
Deutschland:
Marktbasierte Emissionen: Niedrig, wenn Unternehmen erneuerbare Energien über PPAs oder GOs kaufen, insbesondere angesichts der großen Kapazitäten an erneuerbarer Energie in Deutschland.
Standortbezogene Emissionen: Höher als in Schweden, da Deutschland trotz starker Investitionen in erneuerbare Energien immer noch auf Kohle und Erdgas angewiesen ist.
Polen:
Marktbasierte Emissionen: Können reduziert werden, wenn Unternehmen Herkunftsnachweise oder Verträge für erneuerbare Energien erwerben, allerdings sind die Optionen für erneuerbare Energien im Vergleich zu Ländern wie Deutschland oder Dänemark geringer.
Standortbezogene Emissionen: Sehr hoch, da Polen bei der Stromerzeugung stark auf Kohle angewiesen ist.
Zusammenfassend: In der EU werden sowohl marktbasierte als auch standortbasierte Emissionsbilanzierungsmethoden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter Herkunftsnachweise, nationale Netzmixe und regionale Energiemärkte. Marktbasierte Emissionen ermöglichen es Unternehmen, Instrumente für erneuerbare Energien wie Herkunftsnachweise zu nutzen, während standortbasierte Emissionen den tatsächlichen Energiemix der nationalen oder regionalen Netze widerspiegeln. Das komplexe regulatorische Umfeld der EU, einschließlich des ETS und der Richtlinie für erneuerbare Energien, fügt der Emissionsbilanzierung weitere Ebenen hinzu, sodass es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, beide Methoden in ihrer Umweltberichterstattung zu berücksichtigen.
Quellen:
Europäische Kommission. (2021). Österreichischer Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP). Abgerufen von https://ec.europa.eu/energy
Österreichische Energieagentur. (2020). Energiemix Österreichs: 75% Erneuerbarer Strom. Abgerufen von https://www.energyagency.at
Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-EHS). Compliance-Daten für 2020. Abgerufen von https://ec.europa.eu/clima
Herkunftsnachweise (GO). Erneuerbare Energien in Österreich nachverfolgen. Abgerufen von https://www.aib-net.org

